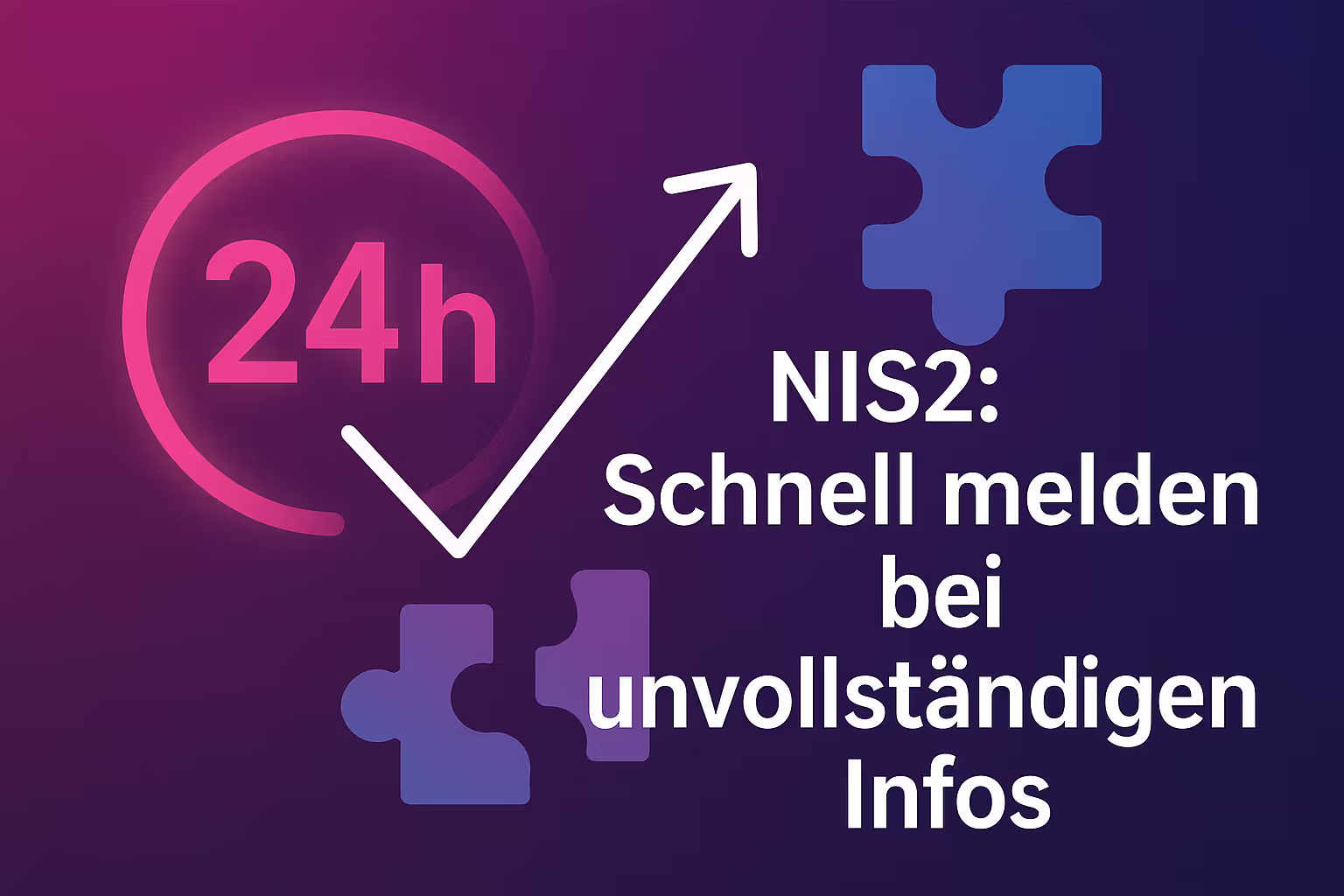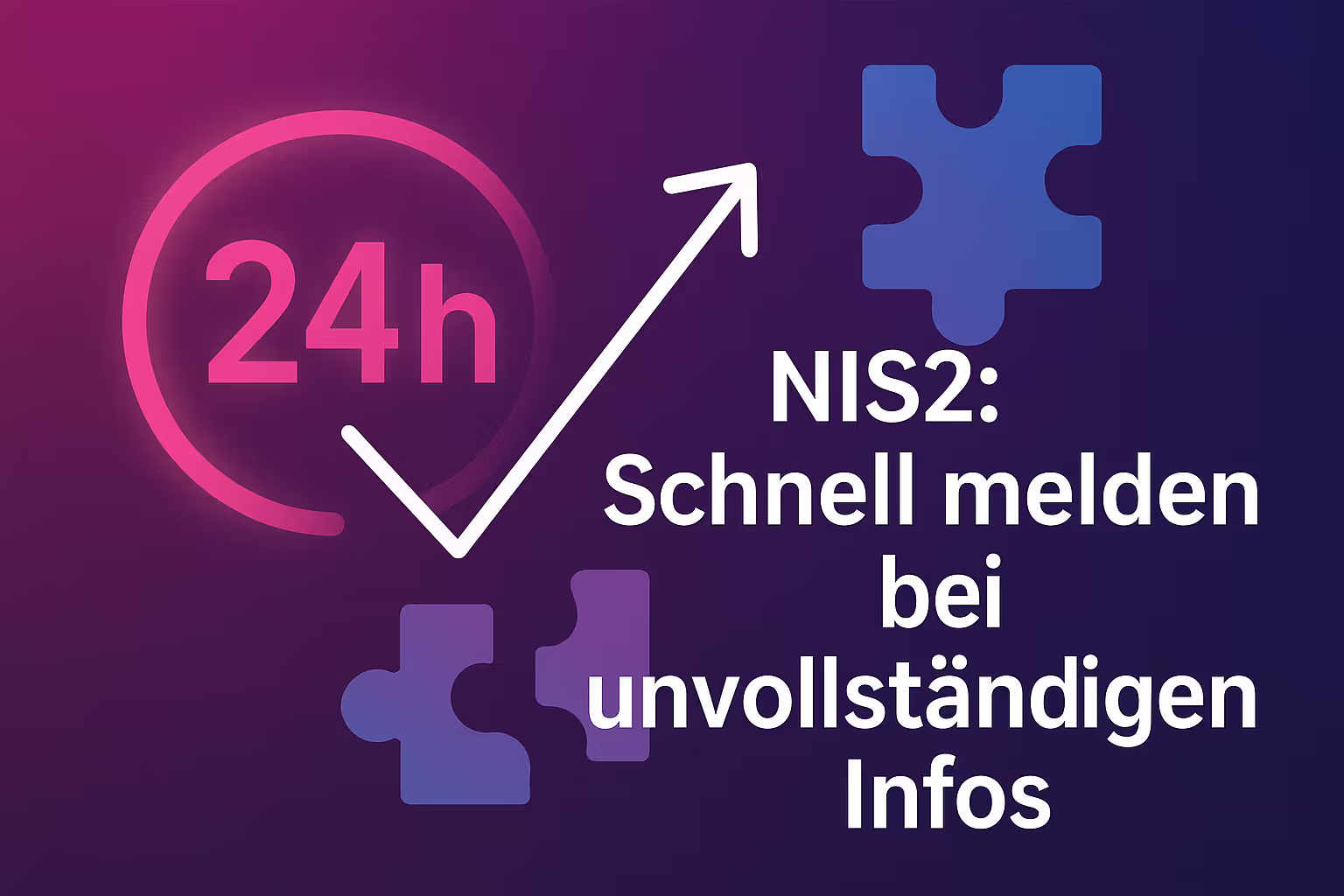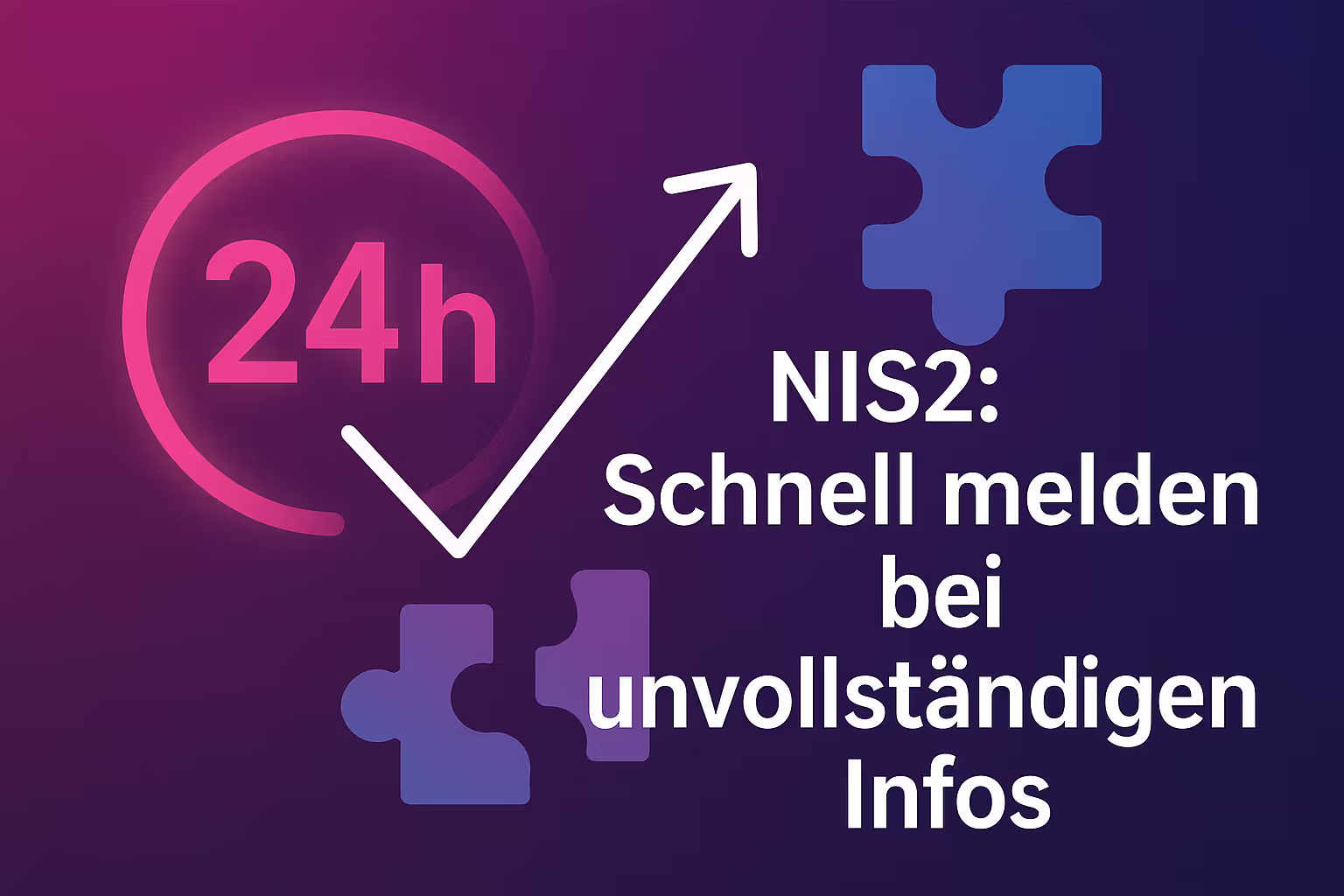Aktualisierung vom 21.11.2025: NIS2 gilt in Deutschland ab dem Tag der Veröffentlichung des Umsetzungsgesetzes im Bundesgesetzblatt, was derzeit für Ende 2025 oder Anfang 2026 erwartet wird. Dann werden die Pflichten für Unternehmen rechtlich verbindlich.
Ein rotes Licht blinkt auf dem Dashboard. Eine kritische Systemwarnung erscheint auf dem Bildschirm. Ein Anruf aus der Fachabteilung meldet einen unerklärlichen Ausfall. In diesem Moment beginnt für viele Unternehmen der Countdown: Die 24-Stunden-Frist der NIS2-Richtlinie zur Meldung eines erheblichen Sicherheitsvorfalls hat begonnen.
Der Druck ist immens. Wie kann man einen Vorfall melden, dessen volles Ausmaß noch völlig unklar ist? Was, wenn die ersten Vermutungen falsch sind? Die Angst, eine unvollständige oder fehlerhafte Meldung abzugeben, führt oft zu einer gefährlichen Lähmung.
Doch genau hier liegt das größte Missverständnis. Die Behörden, allen voran das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), erwarten keine perfekte Analyse innerhalb von 24 Stunden. Ihr Leitsatz lautet: „Schnelligkeit vor Vollständigkeit.“ Dieser Grundsatz ist der Schlüssel, um die erste Hürde der NIS2-Meldepflicht souverän und korrekt zu meistern.
Das Kernprinzip der NIS2-Meldung: Ein Dialog, kein Examen
Die 24-Stunden-Meldung ist kein Abschlusstest, bei dem Sie mit einer einzigen E-Mail alles richtig machen müssen. Betrachten Sie sie stattdessen als das, was sie ist: eine Frühwarnung. Ihr Zweck ist es, die zuständigen Behörden (in Deutschland das BSI) frühzeitig zu informieren, damit diese sich ein Bild von der Lage machen und bei Bedarf andere Unternehmen oder Sektoren warnen können.
Die NIS2 Richtlinie hat hierfür einen klaren, mehrstufigen Prozess etabliert:
- Die 24-Stunden-Frühwarnung: Eine erste, kurze Meldung, die signalisiert: „Es ist etwas passiert.“
- Die 72-Stunden-Meldung: Eine detailliertere Einschätzung des Vorfalls mit ersten Analyseergebnissen.
- Der 1-Monats-Abschlussbericht: Ein umfassender Bericht mit der Ursachenanalyse, den ergriffenen Maßnahmen und den gewonnenen Erkenntnissen.
Dieser gestaffelte Ansatz gibt Ihnen den nötigen Raum, um Informationen schrittweise zu sammeln, zu bewerten und zu ergänzen. Die erste Meldung ist nur der Startschuss für diesen Prozess.
Wann müssen Sie überhaupt melden? Der „erhebliche Sicherheitsvorfall“
Nicht jeder IT-Störfall ist sofort ein meldepflichtiger NIS2-Vorfall. Die NIS2 Meldepflicht greift nur bei „erheblichen Sicherheitsvorfällen“. Ein Vorfall gilt als erheblich, wenn er:
- zu einem schwerwiegenden Ausfall der Dienste führt oder führen kann,
- oder erhebliche finanzielle Verluste für das Unternehmen verursacht,
- oder andere Personen durch Störung des Alltagslebens, finanzielle Verluste oder die Offenlegung persönlicher Daten erheblich beeinträchtigt.
Wenn Ihr Vorfall eines dieser Kriterien erfüllt, beginnt die 24-Stunden-Frist ab dem Moment, in dem Sie Kenntnis davon erlangen.
Ihr Aktionsplan für die ersten 24 Stunden: Ein Leitfaden für den Ernstfall
In der Hektik eines Sicherheitsvorfalls sind klare Abläufe entscheidend. Dieser 5-Schritte-Plan hilft Ihnen, strukturiert und ruhig zu bleiben.
Schritt 1: Erste Triage und Bestätigung
Klären Sie sofort die grundlegendsten Fragen: Handelt es sich um einen echten Sicherheitsvorfall? Betrifft er kritische Systeme? Gibt es erste Anzeichen für einen „erheblichen“ Vorfall im Sinne von NIS2? Dieser Schritt verhindert Fehlalarme und fokussiert Ihre Ressourcen.
Schritt 2: Kernteam für die Reaktion zusammenstellen
Aktivieren Sie Ihr Incident-Response-Team. Dazu gehören typischerweise IT-Sicherheit, IT-Betrieb, die Rechtsabteilung, die Unternehmenskommunikation und die Geschäftsführung. Klären Sie, wer für die Erstellung und Freigabe der Meldung an das BSI verantwortlich ist.
Schritt 3: Informationen sammeln (Was wir wissen & was nicht)
Jetzt geht es darum, die Fakten für die Erstmeldung zu sammeln. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie bereits mit angemessener Sicherheit wissen. Erstellen Sie eine einfache Liste:
- Was wir wissen: z. B. Art des betroffenen Systems, Zeitpunkt der Entdeckung, erste beobachtete Symptome.
- Was wir nicht wissen: z. B. genaue Ursache, volles Ausmaß des Datenabflusses, genaue Anzahl betroffener Nutzer.
Diese Trennung ist entscheidend, um in der Meldung klar zwischen Fakten und Vermutungen zu unterscheiden.
Schritt 4: Die Erstmeldung entwerfen
Nutzen Sie die gesammelten Informationen, um die Meldung zu formulieren. Halten Sie sich kurz und präzise. Im nächsten Abschnitt zeigen wir Ihnen, welche Inhalte zwingend erforderlich sind und wie Sie Unsicherheiten professionell formulieren.
Schritt 5: Meldung einreichen und nächste Schritte planen
Die Meldung erfolgt in der Regel über das Melde- und Informationsportal des BSI. Nach der Einreichung erhalten Sie eine Bestätigung. Dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Meldung genau. Planen Sie sofort die nächsten Schritte für die Analyse, um die 72-Stunden-Frist für die Folgemeldung vorzubereiten.
Die Erstmeldung erstellen: Was muss rein, was kann warten?
Die Vorgaben des BSI zu NIS2 sind klar: Die Erstmeldung soll eine erste Indikation geben. Perfektion ist nicht gefragt, aber einige Kerninformationen sind unerlässlich.
Zwingend erforderliche Angaben (das absolute Minimum)
- Name des Unternehmens: Wer meldet?
- Kontaktinformationen: Wer ist der Ansprechpartner für Rückfragen?
- Art des Vorfalls (soweit bekannt): z. B. Ransomware-Angriff, Datendiebstahl, Systemausfall. Wenn unklar, ist eine allgemeine Beschreibung ausreichend (z. B. „unautorisierter Zugriff auf Server X“).
- Zeitpunkt der Entdeckung: Wann haben Sie den Vorfall bemerkt?
- Erste Einschätzung der Auswirkungen (soweit möglich): Welche Dienste oder Systeme sind betroffen?
„Gut zu wissen“-Angaben (falls verfügbar)
Wenn Sie bereits mehr wissen, können Sie diese Informationen ergänzen. Aber nur, wenn sie bereits als relativ gesichert gelten:
- Vermuteter Angriffsvektor
- Betroffene geografische Regionen
- Bereits eingeleitete Gegenmaßnahmen
Die Kunst der richtigen Formulierung: So kommunizieren Sie Unsicherheit professionell
Der Schlüssel zu einer guten Erstmeldung bei unvollständigen Informationen liegt in der Wortwahl. Signalisieren Sie klar, was Fakt und was eine vorläufige Annahme ist.
Nutzen Sie Formulierungen wie:
- „Nach erster Einschätzung handelt es sich um einen...“
- „Die genauen Auswirkungen werden derzeit noch analysiert.“
- „Wir untersuchen aktuell, ob personenbezogene Daten betroffen sind.“
- „Eine detailliertere Bewertung der Lage wird in der Folgemeldung nach 72 Stunden bereitgestellt.“
Solche Formulierungen schützen Sie vor Falschaussagen und zeigen den Behörden, dass Sie einen professionellen und transparenten Prozess verfolgen, um die volle NIS2-Compliance sicherzustellen.
Nach der Meldung ist vor der Meldung: Der Übergang zur 72-Stunden-Frist
Mit der Abgabe der 24-Stunden-Meldung haben Sie die erste kritische Phase gemeistert. Nun beginnt die intensive Analysephase. Ihre Aufgabe ist es jetzt, die in der Erstmeldung als „unbekannt“ oder „vermutet“ deklarierten Punkte zu klären.
Dokumentieren Sie jeden Schritt Ihrer Untersuchung. Diese Aufzeichnungen sind die Grundlage für Ihre 72-Stunden-Meldung und den späteren Abschlussbericht. Für Unternehmen, die bereits ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) betreiben, sind die Überschneidungen zwischen ISO 27001 und NIS2 hier ein großer Vorteil, da viele Prozesse bereits etabliert sind.
Fazit: Handeln statt Zögern
Die 24-Stunden-Meldefrist von NIS2 ist eine Herausforderung, aber keine unüberwindbare Hürde. Der Grundsatz „Schnelligkeit vor Vollständigkeit“ gibt Ihnen die notwendige Flexibilität, um auch bei unklarer Faktenlage gesetzeskonform zu handeln.
Ein strukturierter Aktionsplan, klare Kommunikation und das Wissen, dass die Erstmeldung nur der Auftakt eines Prozesses ist, nehmen dem Szenario seinen Schrecken. Anstatt in Analyse-Paralyse zu verfallen, können Sie proaktiv und souverän agieren.
Für Unternehmen, die diesen Prozess nicht nur im Ernstfall, sondern dauerhaft meistern wollen, sind automatisierte Lösungen der nächste logische Schritt. Plattformen wie das Digital Compliance Office von SECJUR helfen dabei, die Anforderungen von NIS2 systematisch zu verwalten, von der Risikoanalyse bis zum Vorfallmanagement. So verwandeln Sie reaktiven Stress in proaktive Sicherheit und Compliance.
FAQ: Häufige Fragen zur 24-Stunden-Meldung
Was passiert, wenn ich die 24-Stunden-Frist verpasse?
Das Versäumen der Meldefrist kann als Ordnungswidrigkeit gewertet und mit Bußgeldern geahndet werden. Die Höhe der Strafen ist empfindlich. Deshalb ist es entscheidend, lieber eine unvollständige Meldung pünktlich abzugeben als eine perfekte Meldung zu spät.
An welche Behörde muss ich in Deutschland melden?
Die zentrale Meldestelle ist das Computer Security Incident Response Team (CSIRT) des BSI.
Kann ich eine Meldung zurückziehen, wenn es sich als Fehlalarm herausstellt?
Ja. Wenn sich im Laufe der Untersuchung herausstellt, dass der Vorfall nicht erheblich war, können Sie dies den Behörden in einer Folgemeldung mitteilen und den Vorgang schließen.
Zählt das Wochenende bei der 24-Stunden-Frist mit?
Ja, die Frist läuft in Kalenderstunden. Ein Vorfall, der am Freitagnachmittag entdeckt wird, muss spätestens am Samstagnachmittag gemeldet werden.